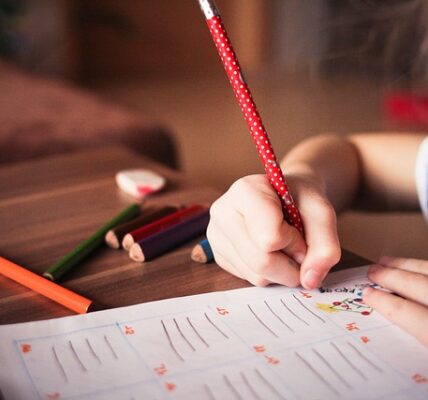Zwischen Anspruch und Realität: Warum Lars Klingbeil bei den sogenannten „Cum‑Cum‑Geschäfte“ nicht einfach abwarten darf
Der neue Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) steht von Beginn seiner Amtszeit unter Druck: Nicht nur, den Haushalt zu konsolidieren — sondern zugleich einen der undurchsichtigsten Steuertrickfälle der Republik voranzubringen. Im Zentrum: die Cum-Cum-Geschäfte, mit denen Banken und Finanzinstitute Milliarden Euro Steuern vermindert oder zurückgeholt haben möchten.
Was steckt hinter den Cum-Cum-Geschäften?
Bei Cum-Cum–Geschäften handelt es sich um Konstruktionen, bei denen ausländische Investoren deutsche Aktien trotz – oder gerade wegen – bestehender Abgeltungssteuer erwerben, um sich Kapitalertragsteuer erstatten zu lassen, die eigentlich nicht gezahlt wurde.
Der Schaden für den Fiskus ist enorm – eine vielzitierte Zahl lautet etwa 28,5 Milliarden Euro.
Demgegenüber stehen bislang vergleichsweise geringe Rückforderungen: Laut Antwort des Finanzministeriums wurden in 81 abgeschlossenen Fällen lediglich rund 226,7 Millionen Euro zurückgeholt – bei 253 Verdachtsfällen ist das mögliche Volumen mit etwa 7,3 Milliarden Euro beziffert.
Klingbeils Priorität: Rückholung oder Signalpolitik?
Mit Blick auf diese Zahlen erhebt die Bürgerbewegung Finanzwende scharfe Forderungen: Direkt nach seinem Amtsantritt wurde Klingbeil aufgefordert, die Rückforderung zur „Chefsache“ zu machen – andernfalls drohe ein unwiederbringlicher Verlust der Milliarden.
Klingbeil selbst signalisierte bereits, dass die Aufbewahrungsfristen von Belegen wieder verlängert werden sollen – ein Hinweis darauf, dass die Zeit drängt.
Doch: Wo genau liegt das Problem? Es sind mehrere Faktoren.
Die Bremsklötze im Verfahren
- Verjährung und Fristen: Einige Verdachtsfälle drohen, nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen nicht mehr effektiv verfolgt werden zu können.
- Komplexe Konstruktionen und internationale Verflechtungen: Cum-Cum–Geschäfte sind juristisch und bilanziell diffizil. Banken, Fonds und Investoren sind vernetzt, Dokumentationen oft lückenhaft.
- Geringe Rückforderungen im Verhältnis zum Schaden: Wie oben genannt: Wenn Milliarden im Raum stehen, aber nur einige Hundert Millionen zurückgeholt wurden, wächst die Erwartungshaltung – und damit die politische Risiko-Komponente.
- Lobbyismus und politische Priorisierung: Aus Sicht von Kritikern wurde bislang nicht mit aller Konsequenz gegen die Finanzindustrie vorgegangen. FR.de
Politisches Kalkül trifft auf realistische Möglichkeiten
Für Klingbeil ist die Situation ein politisches Chance-Fenster: Er kann zeigen, dass Steuergerechtigkeit nicht nur Slogan bleibt. Gleichzeitig ist klar: Wenn nach zwei Jahren kaum substanzieller Fortschritt erkennbar ist, droht das Narrativ von Untätigkeit und Protektion.
Die Mechanismen sind jedoch träge: Ermittlungsverfahren brauchen Zeit, Beweisverwertungen erfolgen selten schnell, Rückforderungen bedürfen zivil- oder steuerrechtlicher Entscheidungen und nicht zuletzt politischen Willens.
Mögliche Szenarien
- Optimistisches Szenario: Klingbeil setzt eine Task-Force auf, verlängert die Beleg-Aufbewahrungsfrist, koordiniert mit den Ländern und erzielt innerhalb kurzer Zeit mehrere Rückforderungen im hohen dreistelligen Millionenbereich – ein Symbol-Erfolg für sein Ressort.
- Pessimistisches Szenario: Die Verfahren bleiben weiterhin schleppend, Banken gewinnen Zeit, Dokumente verschwinden oder werden unbrauchbar, und das Thema verliert in der öffentlichen Wahrnehmung an Schlagkraft – mit politischen Konsequenzen für das Finanzministerium.
Dem Steuerzahler schuldig
Was anfangs wie eine klassische Steuerbeanstandung aussieht, ist in Wahrheit ein Macht- und Glaubwürdigkeits-Test für das Finanzministerium. Wenn Klingbeil hier nicht früh genug und sichtbar handelt, riskiert er nicht nur teures Steuergeld – sondern auch einen Vertrauensverlust beim Wähler, der zunehmend fordert, dass große Finanzinstitute genauso in die Pflicht genommen werden wie kleine Steuerzahler.